Vaterspuren

Dann starb mein Vater, im Juli 2001. Wir waren alle bei ihm, wechselten uns ab in den Tagen davor. Schreckliche Stunden – friedvolle Stunden. Es war ein guter Abschied. Mit seinem Tod konnte etwas Neues beginnen. Eine Annäherung. Mit dem toten Soldatenvater wurde möglich, was mit dem lebenden nicht ging.
Seitdem lese ich verstärkt Biographien aus der Nazizeit. Und ich frage meine Mutter regelmäßiger, intensiver. Ich kontere nicht mehr ständig mit: „Ach komm, ihr habt es doch gewusst. Ihr wolltet einfach nur wegsehen.“ Und ich bin nicht die Einzige. Im Freundeskreis diskutieren wir über Bücher von Günter Grass, Wibke Bruhns oder Anonyma: Dürfen wir unsere Eltern, Großeltern als Opfer sehen? Waren wir nicht immer viel zu unerbittlich? Wie hätten wir uns denn bitte schön verhalten? Und: Ist jetzt, mit Mitte 40, nicht unsere Zeit gekommen, endlich erwachsen zu sein? Zeit, sich mit der Vergangenheit der Eltern zu versöhnen? Den Versuch zu wagen zu verstehen?
Zum ersten Mal befasse ich mich intensiv mit der Soldatenzeit meines Vaters. Das Kriegstagebuch. Ich hatte es nie angeschaut. Jetzt liest mir meine Mutter die Sütterlin-Aufzeichnungen vor. Wochenlang musste das Regiment damals in Emmaus ausharren. Sehnsüchtig warteten sie auf ihren Einsatz. Dann kam der November 1940. Ein Probeschießen war angesetzt worden, mein Vater sollte als beobachtender Offizier daran teilnehmen. Doch es gab eine Fehlzündung, das Geschütz traf die Offiziersgruppe. Der beste Freund meines Vaters starb in seinen Armen, stundenlang lag er im Dreck, bis die Ambulanz kam. Sein Bein lag neben ihm.
Als meine Mutter diese Stelle im Tagebuch vorliest, fange ich an zu weinen.
***
Kurz darauf beginne ich eine neue Lektüre: „Träume recht süß von mir.“ Der Briefwechsel dreier junger Menschen zwischen 1940 und 1942. Der Soldat, Willy, ist genauso alt wie mein Vater, die beiden Mädchen, Hanna und Wanda, sind der Jahrgang meiner Mutter. Ich lese Briefe mit dem Datum Oktober 1940, Januar 1941. Ich bin wie elektrisiert. Das ist genau die Zeit, in der das Tagebuch meines Vaters entstand. In der meine Mutter zu Hause, genau wie Hanna und Wanda, die Hakenkreuzfahne schwenkte, während ihr Bruder, so wie der Buchprotagonist Willy, in Russland stirbt.
In der Redaktion schlage ich vor, sich näher mit dieser Generation zu befassen, sich an der gesellschaftlichen Diskussion über das Leid der Täter und Mitläufer zu beteiligen. Skepsis schlägt mir entgegen. Man hält mir vor, wie kurz der Weg vom Verstehen zum Entschuldigen sei, wie groß unsere Verantwortung gegenüber den Opfern des Nationalsozialismus. Dass die Modewelle des Erinnerns bereits überschlage und sich bald ins Gegenteil verkehren könne: in eine neuerliche Abrechnung mit den Tätern.
Doch dann erzähle ich von meinem Vater. Von dem Kriegstagebuch, von seiner Verwundung am 13. November 1940. Dass meine Mutter mir diese Stelle schon einige Male vorgelesen habe und wie tief mich dies jedes Mal berührt.
Und wenn ich hinfahren würde?, sage ich. Nach Holland? Dorthin, wo er verwundet worden ist? Keiner aus der Familie ist je da gewesen.
Zuerst brauche ich Gewissheit, was damals geschehen ist. Ich recherchiere in Freiburg und Potsdam. Gibt es Unterlagen zu dem Unfall? Immerhin kenne ich das genaue Datum und den Ort: 22. Infanteriedivision, 13. November 1940, 13 Uhr, Große Peelstellung, Holland.
Anfang Oktober klingelt in der Redaktion das Telefon: Herr Erdmann aus Freiburg, vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt. Ja, er hätte was gefunden, immerhin sei das ein schwerer Unfall gewesen, damals: 22 Tote, viele Schwer- und einige Dutzend Leichtverletzte. Wie denn mein Vater hieß? Auch Heintze, sage ich. „Klaus Heintze? Leutnant? Rechtes Wadenbein zerschmettert? Links schwere Verwundungen?“ fragt er.
Es ist wie ein Stich in der Magengegend. Oder am Herz. Gleichzeitig könnte ich Hurra schreien. Ja, es war so, es hat tatsächlich stattgefunden. Ich finde seine Spuren. Seine Vergangenheit wird zu meiner Geschichte.
Ich erzähle meiner Mutter davon und frage, ob sie mit nach Holland kommen würde. Wir könnten die Chance nutzen. Wir können miteinander reden, wir können zusammen trauern und erinnern. Sie will es sich überlegen. Meine Geschwister sind skeptisch. Wird das nicht zuviel für sie? Was soll das Ganze überhaupt?
Ich bin entschlossen zu fahren. Auch meine Mutter willigt ein. Ich finde das toll und bin stolz auf ihren Mut. Sie schlägt ein Datum vor: den 64. Jahrestag seiner Verwundung. Auf den Tag genau werden wir dort stehen. Auf die Stunde genau, um 13 Uhr.

Ich träume von meinem Vater. Er war sehr groß, ein stattlicher Mann. Sah man ihn von Ferne, hat er laut gerufen und gewunken – mit dem Gehstock. So sehe und höre ich ihn jetzt. Oder ist das alles Gedankenkitsch? Ich rufe mich selbst zur Ordnung.
Ende Oktober steht unsere Route. Über das belgische Fremdenverkehrsamt stoße ich auf das Heimatmuseum in Weelde. Ich schreibe Marc Vermeeren. Er antwortet, freut sich auf unser Kommen.
Jetzt sehe ich der Reise geradezu euphorisch entgegen. Immer deutlicher kann ich mir vorstellen, wie alles ablaufen wird. Wie wir an der ehemaligen Großen Peelstellung stehen und an ihn denken, wie wir uns wünschen, dass er in diesem Moment bei uns sein könnte.
***
Wir fahren. Ich sehe aus dem Zugfenster über weites, plattes Land. Seit dem Morgen ist meine Laune schlecht. Wo ist die Vorfreude hin? Mein Unternehmen kommt mir hohl und unnötig vor, je mehr meine Mutter und ich uns dem Ziel nähern. In einem Zeitungsartikel, den ich mir zur Vorbereitung ausgerissen hatte, lese ich einen kritischen Beitrag über die „sich ausbreitende Erinnerungsgemeinschaft der Kriegskinder“. Sie würde die Vergangenheit neu entdecken: „Im Zentrum dieser Umcodierung stehen: die Deutschen als Opfer.“
Der Text passt genau in meine Stimmung. Nun bin ich also auch noch eine Mitläuferin geworden. Auf einer Welle sentimentaler Phantasien schwimme ich in die Arme der Tätergeneration. Das hat mir gerade noch gefehlt.
In Turnhout, einer wunderschönen Kreisstadt östlich von Antwerpen, haben wir ein nettes Hotel. Ich bin froh, erst mal eine Stunde allein im Zimmer zu sein. Was ist los mit mir? Das Abendessen ist eine Katastrophe. Ich trinke zu viel Wein und streue, als meine Mutter und ich über meinen Vater reden, bissige Bemerkungen ein. Na, die haben es sich ja gut gehen lassen. Wir kommen auf ein paar unangenehme Familienthemen zu sprechen. Ich bin hart und unfreundlich. Meine Mutter ist verletzt. Zu Recht. Ich schlafe unruhig.
Dann stehen wir an der Landstraße zwischen Poppel und Weelde, warten auf Marc Vermeeren. Er kommt, wir fahren in das kleine Heimatmuseum. Marc ist unglaublich herzlich. Mit seinem gebrochenen Deutsch unterhält er sich blendend mit meiner Mutter. Ich komme mir gleich als Außenseiterin vor, und in Emmaus wird alles noch schlimmer. Die Schwestern empfangen uns wie Ehrengäste. Wir dürfen am Gottesdienst teilnehmen, im Speisesaal ist schon der Tisch gedeckt.
Meine Mutter erzählt. Nach dem Krieg war mein Vater noch einmal nach Emmaus gefahren. Kaum hatte man ihm die Tür geöffnet, war ihm eine der Frauen um den Hals gefallen: „Leutnant Heintze – Sie leben!“ Auch Marc und Schwester Johanna erzählen aus ihren Familien. Bei Marcs Großvater waren acht Soldaten einquartiert. Sie alle wollten nur eins: nach Hause. Schwester Johannas Vater war Zwangsarbeiter in Deutschland. Gut sei es ihm ergangen; nur, wenn der Gauleiter kam, musste er vom Esstisch der deutschen Bauernfamilie verschwinden.
Ich höre kaum noch richtig zu. Es ist wie ein Zeitsprung zurück in die Pubertät. Die alte Leier, alle waren nett und lieb, keiner war ein Nazi. Ich merke, wie es mir im Hals hochsteigt: das Hassgefühl. Wie vor 30 Jahren könnte ich lospöbeln! Ich fasse es nicht. Bin ich dafür hergekommen? Um alles noch mal zu erleben? Ich bin doch jetzt erwachsen, verdammt noch mal!
Ich versuche zu erklären, was mich bewegt. Es funktioniert nicht.
Sonnabend, der 13. November. Ich wollte diesen Tag zelebrieren. Ich wollte meine Mutter in den Arm nehmen. Um Punkt 13 Uhr, genau 64 Jahre nach dem verhängnisvollen Geschützunfall. Ich wollte das Gefühl fühlen, dieses wunderbare Gefühl des Verstehens und des Mitfühlens. So wie in den Monaten vorher, beim Lesen des Tagebuchs. Wenn ich schon da losheulen musste, was würde dann hier geschehen?
Schon morgens nichts als eine große Leere. Ich trödele so lange herum, dass wir erst am Nachmittag die Peelniederung erreichen. Kreuz und quer fahren wir durch die vollkommen einsame Landschaft. Irgendwo hier, im Umkreis von 500 Metern muss es passiert sein. Ist doch auch ganz egal, wir wissen es ja eh nicht ganz genau. Meine Mutter möchte ein Foto. Die Glückliche. Bei ihr funktioniert es! Sie ist bewegt. Sie kann mitfühlen.
Ich schaffe es nicht. So sehr ich mich auch anstrenge. Die Umarmung fällt aus. Die Sache ist geplatzt. Keine großen Gefühle, keine fantastischen Gespräche. Die waren alle schon vorher gelaufen. Ich dränge zur Heimfahrt. Endlich nach Hause.
Im Zug suche ich nach Worten, um meiner Mutter zu erklären, was mit mir los ist. Ich sage: „Ich will das alles gar nicht verstehen. Es war Eure Jugend, Eure Begeisterung und dafür muss ich kein Verständnis haben.“ Sie stimmt zu. Aber eigentlich ist es nicht so, wie ich gesagt habe. Es gibt da ein Verständnis und es gibt es wieder nicht. Ich bin müde, deprimiert und vollkommen ratlos, was ich mit der ganzen Geschichte anfangen soll.
***
Eine Woche später kommt ein großer Briefumschlag von Marc mit einem sehr herzlichen Brief und vielen Fotos von unserer Reise. Ich lasse ihn auf der Ablage in der Küche liegen.
Während ich morgens um sieben das Frühstück für die Kinder mache, fällt er mir wieder ins Auge. Ich überlege, dass meine Mutter und ich uns schriftlich bedanken sollten. Meine Mutter sollte ein Bild von meinem Vater dazulegen, denke ich. Nicht in Uniform, davon hatte Marc genug gesehen. Sondern so, wie ich ihn kannte. Ein Foto meines Vaters eben.
Völlig unerwartet fange ich an zu weinen.

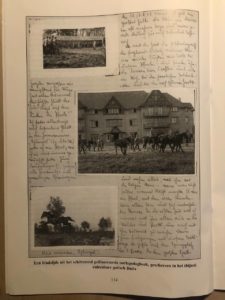


***
Das neue Jahr hat begonnen. Ich habe alles aufgeschrieben und an diesem Bericht gearbeitet. Was wird meine Mutter dazu sagen?
Ich hoffe sehr, dass sich mich verstehen kann. Die Reise war so anders, als ich sie geplant hatte. Trotzdem möchte ich jetzt keine Minute davon missen. Es war eben eine Reise zu dem Soldaten Klaus Heintze. Erst zurück in Hamburg wurde er wieder zu meinem Vater. Ein Vater, der mir durch diese Reise ein Stück näher gerückt und mit dem ich fühlen kann. Nicht jedoch mit dem Soldaten. Das muss ich akzeptieren. Ich glaube, es geht. Aber es ist viel schwieriger, als ich noch vor ein paar Wochen gedacht habe. Und es ist noch lange nicht zu Ende.
***
Dieser Text entstand im Rahmen einer Recherche für das Monatsmagazin chrismon im Jahr 2004. Dorothea Heintze reiste mit ihrer damals 80-jährige Mutter an den Ort der Verwundung ihres Vaters nach Belgien. Ado Heintze ist 2018 verstorben; der Text ist bisher nie veröffentlicht worden. Allerdings hatte der in der Geschichte erwähnte belgische Hobby-Historiker und Gastgeber der beiden deutschen Frauen, Marc Vermeeren, über den Besuch in einem lokalen Stadtmagazin von Weelde und Poppel einen Bericht geschrieben. Aufgrund dieses Berichtes hat sich vor wenigen Wochen ein Vertreter des belgischen Staatsarchivs an Dorothea Heintze mit der Bitte um Zusendung weiterer Materialien gewandt. Man forsche gerade zum Thema Kollaboration und Besatzungszeit.
Auch bei uns lag der Text schon eine Weile und wartete auf den richtigen Zeitpunkt zur Veröffentlichung. Der ist mit dem „Tag der Befreiung“, am 8./9. Mai, von dem viele fordern, er solle ein gesetzlicher Feiertag werden, gekommen. Wir freuen uns sehr, diesen so persönlichen und dabei für viele von uns und unsere Eltern so stellvertretenden Text veröffentlichen zu können und danken Dorothea auf das Herzlichste.
