Die Präsidentin vom Dach

Porträt der Imkerin Erika Mayr
Seit vielen Jahren setzt sich Erika Mayr für eine nachhaltige und respektvolle Bienenzucht in der Großstadt ein. Über das Leben und das summende Arbeiten mit Bienen in Berlin.

Es ist einer dieser Frühlingstage, an dem sich die ganze Stadt darauf vorbereitet, aus dem Winterschlaf zu erwachen. Ähnlich der Knospen an den Bäumen, in denen sich die geballte Kraft der Natur sammelt, kurz bevor sie aufplatzen. Erika Mayr ist auf dem Weg zum ehemaligen Heizkraftwerk Berlin-Mitte. Bewaffnet mit Eimer und alten Honigwaben durchquert sie die dunklen Hallen des Industriebaus, aus denen normalerweise die Bässe des legendären Techno-Clubs „Tresor“ dröhnen würden. Im schmalen Fahrstuhl geht es hinauf in die letzte Etage. Verschlossen hinter einer Stahltür befindet sich hier der Zugang zu ihrer ganz eigenen Welt.
Hoch über den Dächern der Hauptstadt wartet heute eine besondere Begegnung auf die 47-Jährige: das erste Treffen mit ihren Bienen in diesem Frühjahr. Ein einmaliger Moment, auf den sie sich jedes Jahr mit Spannung vorbereitet. „Die erste Durchsicht verrät mir nicht nur, wie es meinen Bienenvölkern geht und ob sie den Winter überstanden haben, sondern sie ist auch eine der wohl sinnlichsten Erfahrungen mit der Natur“, erklärt die Imkerin. Der Blick in den Bienenstock entfessle pure Lebensenergie. Kein Wunder – sobald Mayr den Deckel der Styroporkiste öffnet, in dem sich eines ihrer 20 Bienenvölker befindet, strömt ihr wollige Wärme entgegen.


Auf konstante 35 Grad heizen die sogenannten Winterbienen das Nest mit ihrer Körperwärme an, um das Überleben des Stocks in den kalten Monaten zu sichern. Für diesen Kraftakt benötigen sie rund 15 Kilogramm Honig als Vorrat. Waren die Bienen im Herbst nicht fleißig genug, ist das Volk zu schwach und läuft Gefahr, nicht über die Runden zu kommen. Deswegen hat Mayr zur Sicherheit Reste alter Honigwaben mitgebracht. Doch wider Erwarten summt es auf dem Dach reger, als es für den Frühlingsbeginn üblich ist. Die Bienen sind bereits mit dem Frühjahrsputz beschäftigt, um alles für die erste Brut vorzubereiten.
Dass die Bienenvölker ihre Winterruhe immer häufiger frühzeitig beenden, hängt nicht zuletzt auch mit den schwankenden Temperaturen zusammen. Erika Mayr beobachtet die Aktivität am Stock nicht ohne Sorgen. Die Auswirkungen des Klimawandels würden einige Bienenvölker schwächen und durcheinanderbringen. Behutsam nimmt sie eine der Bienen in die Hand und versucht, sie warm zu pusten. Sie war noch zu schwach, um auszufliegen.
„Bienen sind ein Medium, das uns unmittelbar mit der Natur verbindet.“
Verschiedene Studien, unter anderem an der TU München und der Universität Würzburg, untersuchen die Verhaltensweisen der Bienen im Bezug auf klimatische Veränderungen. Das Projekt „we4bee“ beispielsweise will mit Hightech-Bienenstöcken nachweisen, dass die Tiere eine Art Frühwarnsystem bei Naturkatastrophen besitzen. „Bienen sind ein Medium, das uns unmittelbar mit der Natur verbindet. An ihnen können wir Veränderungen nicht nur ablesen, sondern auch begreifen“, so die Bienenflüsterin.
Wichtig sei es deswegen, die Bienen optimal zu trainieren. Damit sich die Nektarsammler auch an starke Winde und extreme Temperaturen gewöhnen können, platziert die Stadtimkerin ihre Völker genau dort, wo sie nicht verwöhnt werden. Die Dächer der Hauptstadt seien optimal geeignet. Hier oben würden die Tiere neue Resilienzen erlernen und ungestört direkt in die Bäume fliegen können, ohne im Fußgängerbereich aufzutauchen.
„Nicht alle Menschen tolerieren Bienen und das Imkern in der Stadt. Viele bekommen Panik, wenn sie einen Schwarm sehen. Dabei sind es sanftmütige Wesen“, erklärt Mayr. Mit ängstlichen Nachbarn*innen habe sie zu Beginn ihrer Imkerinnentätigkeit oftmals Probleme gehabt. Oben auf dem Dach leben sie dagegen in einer Art Parallelwelt, in die sich auch die Imkerin gern zurückzieht.
Eine Frage des Geschmacks
Das alte Kraftwerk ist einer der insgesamt vier Berliner Standorte Erika Mayrs. Jeder von ihnen habe seine eigene Magie und erzeuge unterschiedlichen Honig. Abhängig sei der Geschmack von den jeweiligen Bäumen in der Umgebung und der Mischung der Blütenpollen. Bis zu drei Kilometer fliegen die Bienen aus, um ihren Nektar zu sammeln. Was da wächst, ist später auch im Honig. So habe beispielsweise der süße Aufstrich, den ihre Bienenvölker auf dem Dach des Zeughofs in Kreuzberg produzieren, eine besonders aromatische Tiefe. Wie blumig der Honig im Frühjahr schmeckt, hängt dagegen vom Anteil des Ahorns und der Rosskastanie im Nektar ab.
Erikas Lieblingsort sei jedoch ohne Zweifel der „Tresor“. Das läge nicht nur am köstlichen Honigmix, sondern auch an der Tatsache, dass hier zwei ihrer ersten Bienenvölker ein Zuhause fanden. Das war vor sieben Jahren. Ihre Leidenschaft für die Imkerei entwickelte die studierte Gartenbauingenieurin jedoch schon 2004. Damals nahm sie mit ihrem Freund an einem Architekturwettbewerb in Detroit teil, der den Bau von Bienenhäusern für regenerative Urban Farming-Projekte in der ehemaligen US-amerikanischen Industrie-Metropole vorsah. Was als kreativer Geistesblitz beim Feierabendbier begann, führte nur wenige Jahre später zu einem der ersten sogenannten „Urban Beekeeping“-Projekte in Berlin.
Die Stadt ist für Bienen mittlerweile der bessere Lebensraum
Wenn die Naturfreundin den ersten Honig im Jahr per Hand schleudert, so sagt sie, stecke darin auch die Seele der Stadt. Geboren in einem kleinen Dorf in Oberbayern und aufgewachsen in Schwaben, zog es die Kosmopolitin schon 1997 nach Berlin. Obwohl die Großstadt sei vielen Jahren ihr Habitat ist, bleibt sie der Natur innig verbunden. Ein Zwiespalt in ihrem Leben, den sie auf gewisse Weise mit den Bienen teilt. Auch für sie ist die Stadt mittlerweile der bessere Lebensraum: „Es mag viele Menschen überraschen, aber auf dem Land finden die Tiere nicht mehr genügend Nahrung. Dann muss man die Stöcke ständig umsetzen, was zusätzlich schadet.“


Eine Ursache für die Hungersnot der Bestäuberinnen seien die zahlreichen Monokulturen der industriellen Landnutzung, welche das natürliche Ökosystem stören. Raps- und Maisfelder, die großflächig mit Pflanzenschutzmitteln behandelt werden, böten den Bienen schon lange keine ausgewogene Nahrungsquelle mehr. Und auch üppig blühende Blumenwiesen seien mittlerweile ein Klischee. Die meisten würden vom Menschen tot gemäht. In der Großstadt profitierten die kleinen Honigproduzentinnen dagegen von längeren Wärmeperioden und unterschiedlichen Blütezeiten. Egal ob auf Brachflächen, am Ufer der Kanäle, in den Parks, auf Verkehrsinseln oder in Schrebergärten – die Bienen fänden hier abwechslungsreiche Nektarquellen, die nicht wie auf dem Land pestizidbelastet seien.
Berlin ist Zentrum der deutschen Stadtimkerei
Zudem sei der Nektar im Bienenstock immer reiner als der Nektar, den die fleißigen Sammlerinnen in den Blüten vorfinden. Grund dafür ist ein natürlicher Überlebensmechanismus der Bienen: Schadstoffe oder Staubpartikel werden beim Abtransport in der Honigblase im Körperinneren gefiltert. Da Pestizide jedoch nicht so leicht zu filtern sind wie zum Beispiel Feinstaub und Ruß, sei auch die Qualität des Stadtbienenhonigs meist höherwertig. Mit mehr als 400.000 Bäumen ist die Tafel für die kleinen Feinschmeckerinnen in Berlin nicht nur reichhaltig, sondern vor allem vielfältig gedeckt. Das steckt später auch im Honig, der uns nicht nur mit der ganzen Stadt verbindet, so Mayr, sondern unser Immunsystem gerade in Zeiten der Corona-Pandemie stärkt.
Während Mayr mit einem mittelgroßen Bienenvolk im Jahr rund 20 Kilogramm Honigertrag verzeichnet, kommen Imker*innen auf dem Land gerade einmal auf drei. Das trug in den vergangenen Jahren zu einem Boom der Stadtimker*innen bei. Rund 2.000 davon gibt es mittlerweile in Berlin. Das macht die Hauptstadt zum Zentrum der deutschen Stadtimkerei und hilft dem lange Zeit gefürchteten Sterben der Honigbiene entgegenzuwirken.
Doch Mayr, die als erste Frau Präsidentin des Deutschen Berufs- und Erwerbsimkerbund war, warnt vor einem auf Ertrag fixiertem Geschäft: „Beim Imkern sollte es nicht darauf ankommen, wie viel Honig man produziert, sondern wie vernetzt die Bienenvölker sind.“ Aussterben werde die Biene nicht so schnell – im Gegenteil: Weltweit seien die Populationen sogar angestiegen. „Bienen passen sich glücklicherweise besser an die Natur an als der Mensch“, so Mayr.
Für Erika Mayr sind die Bienen wahre Lehrmeisterinnen
Die Beziehung zwischen Biene und Mensch reicht weit in die Vergangenheit zurück. Eine 10.000 Jahre alte Höhlenzeichnung, die Forscher in Spanien entdeckten, zeigt bereits „Honigjäger“ beim Ernten von Bienenstöcken. Mit der Stadtimkerei erlebt die uralte Tradition eine Wiederbelebung, die nicht nur Umweltaspekte betrifft, sondern auch eine schrittweise Auflösung des Stadt-Land-Gefälles. Ökologische Initiativen in den Städten wie das Imkern oder das urbane Gärtnern und Anbauen von Gemüse und Obst – „Urban Farming“ genannt – drücken nicht nur unsere Sehnsucht zur Natur aus, sondern stehen stellvertretend für die Notwendigkeit, künftig nachhaltige Lebens- und Ernährungsweisen im urbanen Kontext zu integrieren.
Für Erika Mayr sind die Bienen wahre Lehrmeisterinnen. Sie symbolisierten zum einen Freiheit und Kollektivität, zum anderen machten sie Grenzen deutlich und ließen uns Ausdauer und Zielstrebigkeit erkennen. „Abgesehen davon ist ein Bienenstock das wohl bestorganisierteste Matriarchat der Welt“, scherzt Mayr. Gerade in unsicheren Zeiten wie der Corona-Krise seien die Bienenvölker für sie Trost und Segen gleichermaßen. Derzeit die Stunden mit ihnen verbringen zu dürfen, anstatt ständig in Videokonferenzen präsent zu sein, sei ein unschätzbarer Wert und helfe ihr, fokussiert im Leben zu bleiben. Ein Leben, das dank der Bienen angefangen hat zu summen.
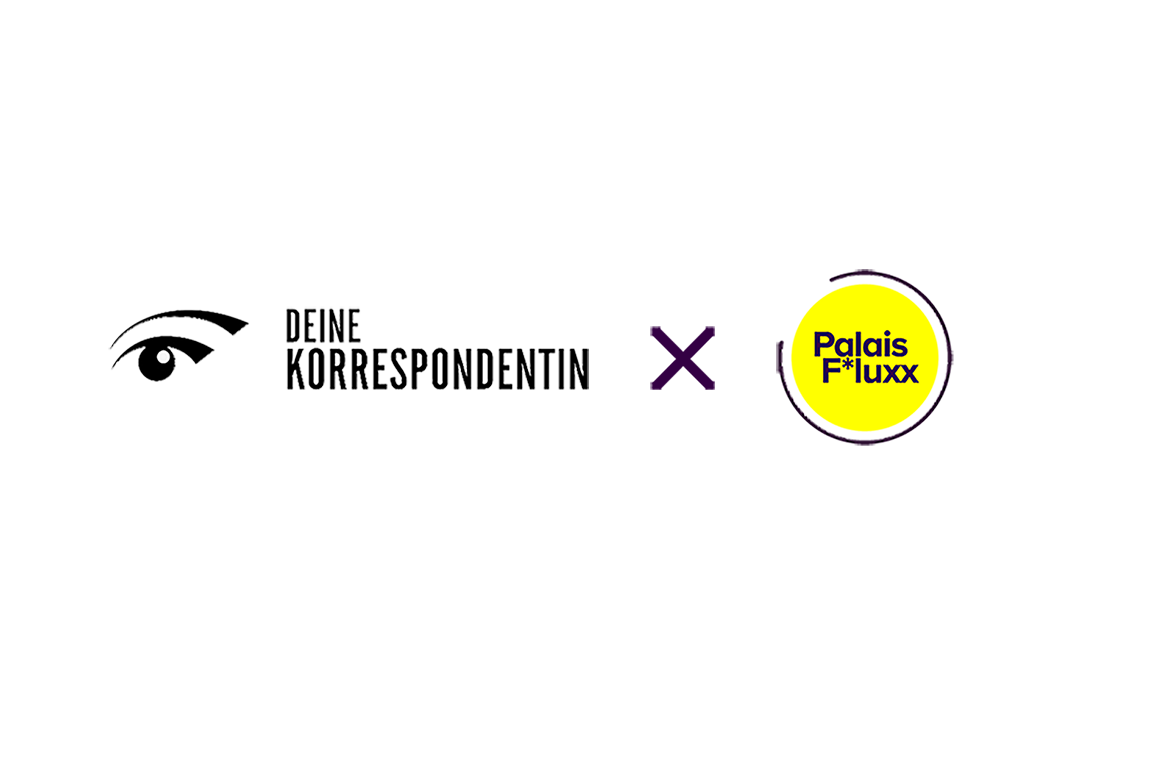
Autorin des Beitrags ist Helen Hecker für »Deine Korrespondentin«, ein Onlineportal, das ausschließlich über Frauen berichtet. Wir danken für die Freigabe zur Veröffentlichung und freuen uns über die Zusammenarbeit!
Fotos: ©Helen Hecker
An dieser Stelle weichen wir von unserem Anspruch, dass die Frauen, deren Arbeiten auf unserer Seite veröffentlicht werden, mindestens 47 Jahre alt sein müssen, ab. Kriterium ist, dass die Protagonist*innen mindestens 47 sind.
